Schnellnavigation
- 1 Erkenntnisse aus der Gender-Medizin werden für individuelle Gesundheit immer wichtiger
- 2 Auslöser, Symptome und Bewältigungsstrategien von Stress unterscheiden sich zwischen Frau und Mann
- 2.1 Sportblog.cc: Frau Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Sie wurden für Ihre Forschungen zur Gender-Medizin 2016 mit dem Titel „Wissenschaftlerin des Jahres“ ausgezeichnet. Könnten sie für Laien kurz erklären, was Gender-Medizin ist?
- 2.2 Inwiefern unterscheidet sich der Organismus von Frauen und Männern?
- 2.3 Spielen bei Krankheitsrisiken auch die unterschiedlichen sozialen Lebenswelten der Geschlechter eine Rolle?
- 2.4 Sie haben als wissenschaftliche Leiterin im „La Pura“ Gesundheitsresort 2017 ein umfassendes Anti-Stress-Programm speziell für Frauen entwickelt. Haben Frauen tatsächlich „anders“ Stress als Männer?
- 2.5 Gibt es beim Stress jetzt auch biologische Unterschiede? Äußert sich Stress in Frauen- und Männerkörpern anders?
- 2.6 Gibt es auch von der psychischen Seite her Unterschiede?
- 2.7 Ist Bewegungsmangel bei Frauen denn stärker ausgeprägt als bei Männern?
- 2.8 Wie läuft im La Pura ein Anti-Stress-Programm für Frauen ab? Wie kann man sich das vorstellen?
- 2.9 Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen können Sie Lesern mitgeben, die bewusst Stress reduzieren wollen?
- 2.10 Sie haben zuvor Sport angesprochen. Warum hilft Sport gegen Stress?
- 2.11 Sie haben vorhin von negativem Stress gesprochen. Meine letzte Frage: Gibt es auch positiven Stress und wenn ja, wie kann man Druck konstruktiv nutzen?
- 3 Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer erklärt im Video-Interview den aktuellen Wissensstand zur Stressforschung in der Gender-Medizin
Der kleine Unterschied zwischen Frau und Mann. Gleichberechtigungs-Aktivisten argumentieren ihn gerne unter den Tisch, Feministinnen kehren ihn öffentlichkeitswirksam hervor, Individualisten bescheinigen ihm mit dem Credo „wir sind ohnehin alle verschieden“ nur eine Randexistenz.
Tatsächlich haben Menschen als Spezies mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Wir sind unabhängig der Ausprägungsform unserer Geschlechtsorgane, der ethnischen Herkunft usw., Lebewesen mit gleichen sozialen und körperlichen Bedürfnissen. Das anzuerkennen ist die Basis jeder modernen Gesellschaft und sollte in Form von Wertschätzung und Respekt jeglicher Art immer im Bewusstsein bleiben.
Erkenntnisse aus der Gender-Medizin werden für individuelle Gesundheit immer wichtiger
Umso mehr jedoch bestmögliche medizinische Betreuung in den Mittelpunkt rückt, umso eher gewinnen die Unterschiede der Geschlechter an Bedeutung. Denn es gibt biologische wie auch gesellschaftliche Besonderheiten bei Frauen und Männern, die, wenn sie ignoriert werden, zum Verschreiben unpassender Medikamente oder sogar zu medizinischen Fehldiagnosen führen können.
Mit genau jenen geschlechtsspezifischen Unterschieden beschäftigt sich seit einigen Jahren der Fachbereich „Gendermedizin“. Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer gilt als internationale Koryphäe und deutschsprachige Vorreiterin auf dem Gebiet. 2010 erhielt sie den ersten Lehrstuhl für Gendermedizin an der Universität Wien, seither etablierte sie den Universitätslehrgang „Gender Medicine“ und forciert als Obfrau der „Österreichischen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin“ durch zahlreiche Forschungen den diesbezüglichen Wissensstand.
Auslöser, Symptome und Bewältigungsstrategien von Stress unterscheiden sich zwischen Frau und Mann
Die gesundheitlichen Auswirkungen des biologischen (sex) und des sozialen Geschlechts (gender) sind tief in unseren Alltag verflochten. Ein aktuell besonders spannendes Thema ist in diesem Zusammenhang die Stress-Forschung. Welche Faktoren zu Stress führen, welche Symptome entstehen und welche Maßnahmen entgegenwirken unterscheidet sich nämlich ebenfalls zwischen Frau und Mann.
In der modernen Arbeitswelt ist kaum jemand nicht von Stress betroffen. Der umsichtige Umgang mit den Anforderungen, die man selbst an sich stellt, aber auch jenen, die vom Umfeld an einen herangetragen werden, ist zu einer zentralen Kompetenz geworden. Stress gilt inzwischen als einer der potentesten Auslöser für Krankheiten. Umso besser man sich und seine Bedürfnisse kennt, umso eher erlernt man einen konstruktiven Umgang mit Erfolgsdruck, Ehrgeiz, Perfektionismus und Co.
Das Interview mit Prof. Dr. Kautzky-Willer, welches ich im August 2017 im Auftrag der deutschen Fitness-Zeitschrift „shape up“ führen durfte, hat mir persönlich sehr aufschlussreiche Einsichten zur individuellen Stress-Entstehung geliefert. Frauen und Männer haben offenbar tatsächlich „anders“ Stress.

Fotocredit: filmkraft.wien
Folgend könnt ihr die textliche Zusammenfassung des Interviews lesen. Am Ende findet ihr das gesamte Interview auch als Video.
Sportblog.cc: Frau Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Sie wurden für Ihre Forschungen zur Gender-Medizin 2016 mit dem Titel „Wissenschaftlerin des Jahres“ ausgezeichnet. Könnten sie für Laien kurz erklären, was Gender-Medizin ist?
Alexandra Kautzky-Willer: Man könnte es auch geschlechtsspezifische Medizin nennen. Es geht darum, dass Frauen und Männer für bestimmte Krankheiten oft unterschiedliche Risikofaktoren haben, bei gleichen Krankheiten unterschiedliche Symptome entwickeln und die Diagnosemethoden bei den Geschlechtern oft unterschiedlich sensitiv sind. Auch bei der Behandlung müsste das Geschlecht berücksichtigt werden, damit das Ergebnis bei Frau und Mann letztlich gleich gut ausfällt. Es geht bis hin zu unterschiedlicher Lebenserwartung.
Inwiefern unterscheidet sich der Organismus von Frauen und Männern?
Primär gibt es natürlich genetische Unterschiede durch die Geschlechtschromosomen. Aber wir kennen heute auch generelle Unterschiede in der Anatomie, im Organaufbau, in der Durchblutung von Organen und in der Verdauungsfunktion. Diese Nuancen entwickeln sich schon im Mutterleib und beeinflussen stark die folgende Entwicklung. Bereits die Hirnentwicklung ist bei männlichen Feten beispielsweise anders, durch die Einwirkung von Testosteron. All das setzt sich fort bis ins hohe Alter, wobei wir uns im ganz hohen Alter biologisch wieder angleichen.
Insbesondere spielen auch die Sexualhormone in der Gendermedizin eine große Rolle. Diese sind altersabhängig – wir haben große Unterschiede zwischen Pubertät und Menopause, die bei Frauen mit starken körperlichen wie psychischen Veränderungen assoziiert sind. Daher kann man Frauen und Männer eigentlich nicht als homogene Gruppe betrachten und gendermedizinische Aspekte hängen immer auch stark vom Alter ab.
Spielen bei Krankheitsrisiken auch die unterschiedlichen sozialen Lebenswelten der Geschlechter eine Rolle?
Natürlich, sozialpsychologische Faktoren und der Körper sind stark verzahnt. Die Biologie, die Gene, die Hormone, die Enzymfunktionen sind eine Sache. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft an die Rolle als Frau oder Mann beeinflusst aber ebenso die typischen Krankheitsbilder und umgekehrt. Selbst in Tierversuchen konnte man bislang nicht sicher ausschließen, ob etwa Krankheitshäufigkeiten nur aufgrund differenzierter Biologie auftreten. Affen beispielsweise haben starke soziale Bindungen und Netzwerke, die die Ergebnisse beeinflussen.
Sie haben als wissenschaftliche Leiterin im „La Pura“ Gesundheitsresort 2017 ein umfassendes Anti-Stress-Programm speziell für Frauen entwickelt. Haben Frauen tatsächlich „anders“ Stress als Männer?
Nun ja, zuallererst sind die Faktoren, die Stress auslösen, mehrheitlich andere. Bei Frauen steht psychosozialer Stress an vorderster Front, also Probleme im direkten Umfeld, mit der Familie oder dem Partner.
Häufig kommt auch Vielfachbelastung dazu. Frauen wollen überall perfekt sein und glauben oftmals, es sein zu müssen. Nach wie vor sind Frauen für den Großteil der Kindersorge zuständig und die Pflege von Familienangehörigen obliegt in Österreich ebenfalls zu 80 % Frauen. Die Zeit für Erholungsphasen, für eine gesunde Partnerschaft oder sich selbst kommt da oft zu kurz.
Bei Männern ist Stress mehr mit dem Beruf oder dem Arbeitsumfeld assoziiert. Pensions-Schock oder Arbeitslosigkeit sind für Männer beispielsweise eher stressauslösend als für Frauen.
Gibt es beim Stress jetzt auch biologische Unterschiede? Äußert sich Stress in Frauen- und Männerkörpern anders?
Die Stressreaktion ist bei Frauen tatsächlich anders gelagert. Die Hirn-Nebennieren-Stressachse, die vom Gehirn gesteuert wird, reagiert bei Frauen tendenziell sensitiver und sie haben dadurch mehr körperliche Reaktionen. Studien haben klar gezeigt, dass Frauen bei Stress häufiger Herzinfarkt oder Schlaganfälle haben. Auch Schlafmangel oder Schichtarbeit, also mangelnde Entspannung, ist beim weiblichen Geschlecht ein stärkerer Faktor, der z.B. Übergewicht, Depressionen, Diabetes oder Herz-Kreislauferkrankungen auslöst. Selbst für die Rehabilitation gibt es Daten, dass Stressreduktion bei Frauen zu günstigeren Langzeitergebnissen führt.
In welchen Beschwerden sich Stress, Angst oder Depressionen konkret manifestieren, ist dann eher individuell. Manche bekommen unspezifische Schmerzen oder Rückenschmerzen ohne erkennbare Ursache am Bewegungsapparat. Wieder andere haben Verdauungsprobleme, Bluthochdruck, Migräne oder Reizdarm. Bei Frauen kommt es nicht selten zu Übergewicht, weil die veränderten Stresshormone nach Süßem und Fettem verlangen. Ein erhöhter Cortisolspiegel führt dann auch zur vermehrten Bildung von Bauchfett.
Gibt es auch von der psychischen Seite her Unterschiede?
Chronischer Stress endet letztlich immer in einer Depression, wenn wir jetzt die Psyche hernehmen. Bei Männern führt Dauerdruck eher Richtung Depersonalisation und Burnout. Sie handeln risikoreicher, werden egozentrischer, kapseln sich von der Umgebung immer mehr ab und empfinden sich am Ende selbst als fremd. Frauen werden hingegen oft noch sozialer und empathischer, wollen noch mehr für andere da sein und erschöpfen emotional dann völlig.
Der Bewältigungsstil von Stress unterscheidet sich in der Regel ebenfalls. Männer tendieren zur „fight or flight“-Reaktion, also entweder Kampf oder Flucht. Man vermutet, dass das evolutionsbiologisch begründet ist. In jedem Fall wird hier sofort Energie abgelassen, ob ich jetzt kämpfe oder fliehe. Frauen praktizieren öfter einen grübelnden Bewältigungsstil. Sie internalisieren, versuchen, sich gemeinsam in der Gruppe zu schützen und gegenzusteuern. Es ist ein ganz anderes Verhalten, bei dem es eher zu einem Stau kommt, weil so wenig Energie frei wird. Deswegen ist Sport für Frauen wahnsinnig wichtig, um einen Ausgleich zu schaffen.
Ist Bewegungsmangel bei Frauen denn stärker ausgeprägt als bei Männern?
Leider ja, das kommt hinzu. Darüber habe ich schon öfter mit Ärzte-Kollegen und Sportwissenschaftlern philosophiert. Wir denken schon, dass bei ganz kleinen Kindern der Bewegungsdrang gleich stark ausgebildet ist. Ab der Pubertät bewegen sich Mädchen dann aber weniger, pausieren im Turnunterricht oder machen weniger Mannschaftssport. Mit dieser Phase, ab dem Alter von etwa 12 Jahren, geht auch ein starker Anstieg an Depressionen einher. Ob es da einen biologischen Hintergrund gibt, bezweifle ich fast. Klar können Frauen bei kraftintensiven Sportarten aufgrund von Muskel- und Gelenksaufbau nicht die Leistung von Männern bringen. Aber vieles ist ganz sicher gesellschaftlich und kulturell beeinflusst.
Gerade Mannschaftssport hätte für Frauen aber einen wichtigen Effekt. Die Teambildung, das soziale networken und das spielerische „sich Messen“ fehlt den Mädchen oft. Da gibt es gerade eine aktuelle Studie der Med-Uni Wien, die zeigt, dass Mädchen von Sportvereinen stark profitieren würden. Nicht nur, dass sie sich mehr bewegen, sie lernen auch miteinander Freude an der Bewegung zu haben.

Fotocredit: filmkraft.wien
Wie läuft im La Pura ein Anti-Stress-Programm für Frauen ab? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben wir ein interdisziplinäres Team aus Psychologen, Ernährungswissenschaftlern, Diätologen, Sportwissenschaftlern und Ärzten. Man muss die Risiko-Konstellation immer individuell eruieren. Wir machen zu Beginn eine umfassende Gesunden-Untersuchung wo wir Werte wie Zuckerbelastung, Insulinempfindlichkeit, Herz-Kreislaufrisiko, Biofeedback und vieles mehr ermitteln. Auch psychologisch wird evaluiert, welche Faktoren bei der Frau die Hauptstressoren sind. Denn oft gibt es eingefahrene Denk- und Handlungsmuster, die man durchbrechen muss.
Daraus wird ein Programm mit persönlichen Schwerpunkten zusammengestellt, denn es braucht nicht jeder alles, sondern jeder das richtige. Eine Ernährungsberatung ist immer dabei und natürlich Bewegung, Bewegung, Bewegung. Sport ist mir das Allerwichtigste. Gesundes Essen ist zwar eine wichtige Basis, aber da sind Frauen meistens schon recht gut informiert, zumindest besser als Männer. Die Bewegung vergessen sie oft. Uns ist es wichtig, ein möglichst breites Bewegungsspektrum anzubieten. Denn die eine wird mit Bauchtanz, die andere bei Kraft-Training mit Personal-Trainer glücklich, wieder andere bei Ausdauertraining, Yoga, Pilates oder Chi Gong.
Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen können Sie Lesern mitgeben, die bewusst Stress reduzieren wollen?
Das Problem ist, dass negativer Stress von vielen Menschen nicht rechtzeitig erkannt wird. Sind einmal gesundheitlich Probleme da, ist der Prozess schon relativ weit fortgeschritten.
⇒ Wichtig wäre eine Art Psychohygiene, bei der man sich regelmäßig fragt: Wie geht es mir? Habe ich genug Zeit für mich selbst? Wie teile ich mir den Tag ein? Komme ich zurecht oder fühle ich mich dauernd unter Druck? Könnte ich Dinge delegieren? Habe ich in meinem Tagesplan genug Pausen einkalkuliert? Nehme ich mir zu viel vor und ist das Pensum überhaupt bewältigbar? Gerade Frauen sagen oft „jaja, das kann ich noch machen“, obwohl die resultierende Arbeitsmenge niemand bewerkstelligen könnte. Und wenn man es dann nicht schafft, hat man auch noch Schuld- und Versagensgefühle.
⇒ Man sollte sich eine Tätigkeit suchen, die einem Freude macht, die man genießen und dabei loslassen kann. Das kann ein Hobby wie Malen sein, Musikhören, ein entspannendes Bad, ein Abend mit Freunden usw. – es ist eine Entdeckungsreise.
⇒ Und unbedingt die Achtsamkeit verbessern. Gerade Frauen haben da oft zu wenig Selbstbewusstsein. Man darf kein schlechtes gewissen haben, wenn man entspannt und sich Zeit für etwas nimmt, das einem Freude bereitet.
Sie haben zuvor Sport angesprochen. Warum hilft Sport gegen Stress?
Sport ist ein wahres Wundermittel ohne Nebenwirkungen und muss in jedem Anti-Stress-Programm enthalten sein. Man kann es gar nicht oft genug sagen, alles wird dadurch besser. Bewegung senkt das Risiko für Übergewicht und Diabetes. Selbst wenn man gar nicht abnimmt, wird die Insulinempfindlichkeit und die Zuckeraufnahme im Muskel verbessert. Auch die Stimmung wird besser und das Osteoporose-Risiko sinkt. Es gibt auch immer mehr Daten, die zeigen, dass länger als 30 Minuten Sitzen am Stück nicht gesundheitsförderlich ist. Man sollte immer wieder kurz aufstehen.
Ich persönlich finde Bewegung in der Natur am schönsten. Der Entspannungseffekt von Wald ist mittlerweile nachgewiesen, weil von den Bäumen Terpene freigesetzt werden, die unser Nervensystem beruhigen. Es funktioniert aber auch schon mit Zimmerpflanzen. Die Farbe grün trägt zusätzlich zur Entspannung bei.
Sie haben vorhin von negativem Stress gesprochen. Meine letzte Frage: Gibt es auch positiven Stress und wenn ja, wie kann man Druck konstruktiv nutzen?
Stress ist in Wahrheit ja nur irgendeine momentane Anstrengung oder Herausforderung, sei es körperlich, seelisch oder emotional. In dem Moment, wo ich diese bewältigen kann und auf die Anspannung eine Entspannung folgt, ist die Wahrnehmung positiv. Bewältigbare Herausforderungen sind eine Energie, die zum Leben notwendig ist und diese kann auch weiter stimulieren, das Leben positiv zu gestalten. Folgt auf eine berufliche Anstrengung beispielsweise Erfolg und Anerkennung, ist das schön und es gibt viel Motivation.
Fehlen hingegen die Erholungsphasen und fühlt man sich hilflos ausgeliefert und überfordert, wird es krankmachend. Und zwar körperlich als auch psychisch. Irgendwann kommt dann die Depression, irgendwann hat man dann die Herz-Kreislauf-Erkrankung oder es beginnt der Teufelskreis mit Stressessen, Bluthochdruck, Übergewicht usw. Also zusammengefasst: Herausforderung ist gut, Überforderung ist schlecht.
Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer erklärt im Video-Interview den aktuellen Wissensstand zur Stressforschung in der Gender-Medizin
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Prof. Dr. Kautzky-Willer nochmal ganz herzlich für das interessante Gespräch bedanken und es freut mich besonders, das OK zur Veröffentlichung auf sportblog.cc bekommen zu haben.
Ihr findet das Thema spannend? Dann könnt ihr euch in folgendem Video das gesamte Interview mit Prof. Dr. Kautzky-Willer ansehen!
Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer
- Internistin
- Oberärztin der Universitätsklinik für Innere Medizin III der Medizinischen Universität Wien
- Professorin für Gender-Medizin an der Medizinischen Universität Wien
- Leiterin der Gender-Medizin Unit der Medizinischen Universität Wien
- Leiterin des Universitätslehrgangs „Gender-Medizin“ der Medizinischen Universität Wien
- Obfrau der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin
- Vorstandsmitglied der Österreichischen Diabetesgesellschaft
- Vorstandsmitglied der Österreichischen Adipositas Gesellschaft
- Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Geschlechterforschung
- Wissenschaftlerin des Jahres 2016









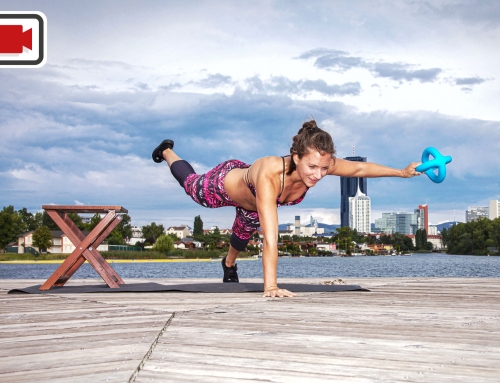



[…] Hier gehts zum Bericht! […]
[…] Hier gehts zum Bericht! […]